Eine professionelle technische Dokumentation ist viel mehr als nur eine lästige Pflicht. Sie ist ein entscheidender Baustein, der über die Benutzerfreundlichkeit Ihres Produkts mitentscheidet, Supportkosten drastisch senkt und Sie vor rechtlichen Fallstricken bewahrt. Die Qualität Ihrer Doku entscheidet am Ende oft über den Erfolg am Markt.
Warum gute technische Dokumentation unverzichtbar ist
Man könnte sagen, eine erstklassige technische Dokumentation ist das unsichtbare Rückgrat jedes erfolgreichen Produkts. Sie schlägt die Brücke zwischen komplexer Technologie und dem Anwender, der einfach nur eine klare, verständliche Anleitung sucht. Ohne sie bleibt selbst das innovativste Produkt ungenutzt oder wird falsch bedient – das Ergebnis sind frustrierte Kunden und teure Anrufe beim Support.

Haftungsrisiken proaktiv minimieren
Ein ganz zentraler Punkt ist die rechtliche Absicherung. Unvollständige oder fehlerhafte Anleitungen können im Schadensfall zu ernsthaften Haftungsansprüchen führen. Eine präzise Dokumentation, die alle Sicherheitswarnungen und Nutzungshinweise glasklar kommuniziert, ist Ihre erste und wichtigste Verteidigungslinie.
Gerade für ein effektives Third-Party Risk Management ist eine saubere technische Dokumentation essenziell. Sie hilft dabei, potenzielle Risiken mit externen Partnern frühzeitig zu erkennen und zu steuern, weil sie als Nachweis dient, dass Sie Ihren Sorgfaltspflichten nachgekommen sind.
Die gesetzlichen Anforderungen in Deutschland, insbesondere die EG-Maschinenrichtlinie von 1995 mit ihrer CE-Kennzeichnungspflicht, haben die Bedeutung dieses Themas massiv verstärkt. Seitdem sind Hersteller zu umfassenden, normgerechten Dokumentationen verpflichtet, was viele Unternehmen dazu zwingt, sich externe Expertise ins Haus zu holen.
Supportkosten spürbar senken
Denken Sie mal darüber nach: Jede Frage, die ein Kunde durch einen schnellen Blick ins Handbuch selbst klären kann, ist eine Supportanfrage, die Ihr Team nicht bearbeiten muss. Eine gut strukturierte Dokumentation agiert quasi als Ihr 24/7-Supportmitarbeiter, der die häufigsten Probleme löst, bevor sie überhaupt bei Ihnen ankommen.
Eine Investition in klare Anleitungen rechnet sich oft schon nach wenigen Monaten, allein durch die gesparten Support-Tickets. Sehen Sie Ihre Dokumentation nicht als Kostenfaktor, sondern als ein mächtiges Werkzeug zur Effizienzsteigerung.
Ein Softwareunternehmen hat zum Beispiel seine Online-Hilfe mit anschaulichen GIFs und kurzen Video-Tutorials überarbeitet. Das Ergebnis? Eine Reduzierung der Supportanfragen um über 40 %. Das spricht für sich.
Marktakzeptanz und Kundenzufriedenheit steigern
Der erste Eindruck zählt – und oft ist die Dokumentation der erste echte Kontaktpunkt nach dem Kauf. Eine positive Erfahrung bei der Inbetriebnahme schafft sofort Vertrauen in Ihr Produkt und Ihre Marke.
Wie eine gute Doku das Kundenerlebnis direkt verbessert:
- Schnellere Einarbeitung: Anwender finden sich sofort zurecht und können das Produkt ohne Frust nutzen.
- Gefühl der Sicherheit: Eine verständliche Anleitung vermittelt Kompetenz und gibt dem Kunden das gute Gefühl, bei Ihnen richtig zu sein.
- Weniger Retouren: Erstaunlich viele Produkte werden zurückgeschickt, weil die Kunden an der Einrichtung scheitern – nicht, weil das Produkt fehlerhaft ist.
Eine professionelle Herangehensweise ist also keine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit. Sie schützt Ihr Unternehmen, entlastet Ihre Mitarbeiter und verwandelt einfache Käufer in treue Fans.
Der Grundstein: eine strategische Planung
Eine wirklich gute technische Dokumentation fällt nicht vom Himmel. Sie ist immer das Ergebnis einer sorgfältigen, strategischen Vorarbeit. Bevor auch nur ein Wort geschrieben wird, müssen die Weichen richtig gestellt werden. Wer diesen Schritt überspringt und direkt losschreibt, riskiert, am Ende ein Dokument in den Händen zu halten, das an den Bedürfnissen der Nutzer komplett vorbeigeht – und teure Nachbesserungen erfordert.
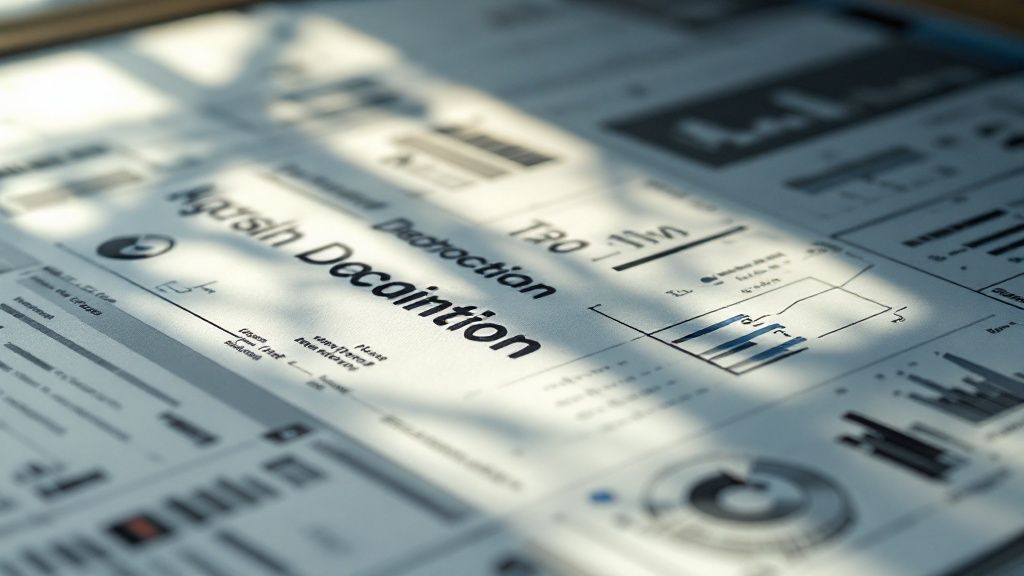
Sehen Sie diesen Plan als Ihre persönliche Roadmap zum Erfolg. Er stellt sicher, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, die Ziele glasklar sind und das fertige Produkt am Ende sowohl den Anwendern als auch dem Unternehmen einen echten Mehrwert bringt.
Das Fundament Ihres Erfolgs: die Zielgruppenanalyse
Der mit Abstand wichtigste erste Schritt ist, Ihre Zielgruppe ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Die zentrale Frage lautet: Wer wird diese Dokumentation lesen? Ein Entwickler braucht schließlich völlig andere Informationen als ein Endanwender ohne jedes technische Vorwissen. Eine ungenaue Zielgruppendefinition ist einer der häufigsten Fehler und kann im schlimmsten Fall die gesamte Dokumentation unbrauchbar machen.
Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln eine komplexe Software für Buchhalter. Die Doku muss deren Arbeitsabläufe aufgreifen, den Fachjargon aus der Buchhaltung nutzen, aber gleichzeitig IT-Begriffe kinderleicht erklären. Würden Sie dieselbe Anleitung für IT-Admins schreiben, läge der Fokus ganz woanders – da ginge es um Installation, Serverkonfiguration und Sicherheitsaspekte.
Um Ihre Zielgruppe greifbar zu machen, haben sich Personas bewährt. Geben Sie Ihren typischen Nutzern Namen, Rollen und definieren Sie deren Kenntnisstand und was sie erreichen wollen.
- Persona A (Anwenderin): Sabine, 45, Buchhalterin. Sie braucht eine simple Schritt-für-Schritt-Anleitung für ihre täglichen Aufgaben. Ihr technisches Wissen ist eher gering.
- Persona B (Administrator): Tom, 32, IT-Systemadministrator. Er sucht technische Details zur Installation, Wartung und zu Backups. Sein technisches Wissen ist hoch.
Diese einfache Unterscheidung hilft Ihnen enorm dabei, die Inhalte passgenau zuzuschneiden und sicherzustellen, dass jeder genau die Informationen findet, die er oder sie gerade braucht.
Umfang und Inhalte klar definieren
Sobald Sie wissen, für wen Sie schreiben, legen Sie den Umfang (Scope) fest. Was muss die Dokumentation abdecken – und, fast noch wichtiger, was nicht? Ohne diese klare Abgrenzung ufern Projekte schnell aus. Ein sauberes Scoping schützt Sie vor dem gefürchteten „Scope Creep“, bei dem ständig neue Anforderungen dazukommen und das Projekt irgendwann sprengen.
Ein klar definierter Umfang ist Ihr Schutzschild gegen endlose Korrekturschleifen. Er schafft Verbindlichkeit für alle Stakeholder und stellt sicher, dass das Projekt im Zeit- und Budgetrahmen bleibt.
Erstellen Sie als Nächstes eine grobe Gliederung oder ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis. Dieser „Dokumentationsplan“ wird zur Roadmap für den gesamten Schreibprozess. Darin sollten alle Hauptkapitel und wichtigen Unterpunkte stehen, die behandelt werden müssen.
Das richtige Format und Medium auswählen
Wie sollen Ihre Nutzer auf die Informationen zugreifen? Die Wahl des Formats hat einen gewaltigen Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit. Ein gedrucktes Handbuch mag für eine schwere Industriemaschine noch sinnvoll sein. Für eine Software-Anwendung ist eine interaktive Online-Hilfe aber in den meisten Fällen die deutlich bessere Wahl.
Hier sind ein paar gängige Formate:
- Klassisches PDF-Handbuch: Ideal, wenn Inhalte offline verfügbar sein oder ausgedruckt werden müssen.
- Online-Wissensdatenbank (Knowledge Base): Super durchsuchbar, leicht zu aktualisieren und perfekt für FAQs und Anleitungen.
- Integrierte Hilfe (In-App Help): Bietet Unterstützung genau dort, wo der Nutzer sie braucht – direkt in der Anwendung.
- Video-Tutorials: Unschlagbar, um komplexe Abläufe einfach und visuell zu erklären.
Die Entscheidung hängt natürlich stark von Ihrer Zielgruppe und dem Produkt ab. In der Praxis hat sich oft eine Kombination verschiedener Formate als die effektivste Lösung erwiesen. So kann ein kurzes Einrichtungsvideo zum Beispiel wunderbar durch eine detaillierte Online-Hilfe ergänzt werden.
Vergessen Sie bei alledem nicht die interne Kommunikation. Die Planung und Abstimmung solcher Projekte erfordert eine zuverlässige Infrastruktur. So ist beispielsweise das Wissen, wie Sie eine professionelle E-Mail mit eigener Domain einrichten, eine grundlegende Voraussetzung für die reibungslose Zusammenarbeit im Team. Dieser strategische Ansatz stellt sicher, dass Sie nicht einfach nur ein Dokument erstellen, sondern eine wertvolle Ressource, die Ihre Nutzer wirklich weiterbringt.
Die richtigen werkzeuge für ihre dokumentation auswählen
Die Wahl der richtigen Software ist Gold wert, wenn man technische Dokumentation erstellt. Sie entscheidet darüber, ob der Prozess glatt und effizient läuft oder zu einem frustrierenden, zeitraubenden Albtraum wird. Klar, für eine kurze Anleitung reicht vielleicht ein einfaches Textprogramm. Sobald die Projekte aber komplexer werden, stößt man damit brutal schnell an die Grenzen. Themen wie Versionierung, die Wiederverwendung von Inhalten oder das Publizieren in verschiedenen Formaten werden dann zu echten Herausforderungen.
Die folgende Übersicht zeigt ein paar moderne Werkzeuge, die den ganzen Prozess deutlich einfacher und professioneller machen können.

Man sieht sofort: Es gibt nicht das eine perfekte Tool. Vielmehr ist es das Zusammenspiel verschiedener Anwendungen – von der reinen Texterstellung bis zur Diagrammerstellung –, das den modernen Arbeitsplatz eines technischen Redakteurs ausmacht.
Werkzeugkategorien im überblick
Die Welt der Doku-Tools ist riesig und auf den ersten Blick unübersichtlich. Im Grunde lassen sie sich aber in ein paar Hauptkategorien einteilen, die für unterschiedliche Bedürfnisse und Teamgrößen passen.
- Wiki-Systeme (z. B. Confluence, DokuWiki): Diese Plattformen sind auf Zusammenarbeit und Agilität ausgelegt. Perfekt für die interne Dokumentation von Softwareprozessen oder als zentrale Wissensdatenbank. Hier können viele Leute gleichzeitig und unkompliziert Inhalte erstellen und aktuell halten.
- Hilfe-Autoren-Tools (HATs) (z. B. MadCap Flare, Help & Manual): Das ist Spezialsoftware, die darauf optimiert ist, Inhalte aus einer einzigen Quelle in verschiedenste Formate zu bringen – sei es eine Online-Hilfe, ein PDF oder eine Wissensdatenbank. Ideal für klassische Benutzerhandbücher und Produkthilfen.
- Component Content Management Systeme (CCMS) (z. B. Schema ST4, Paligo): Willkommen in der Königsklasse. In einem CCMS verwaltet man keine ganzen Dokumente mehr, sondern kleine, wiederverwendbare Inhaltsbausteine, sogenannte Komponenten. Das ermöglicht eine wahnsinnige Effizienz bei der Wiederverwendung von Texten und bei Übersetzungen. Der Haken? Die Anschaffung und Implementierung sind entsprechend aufwendig.
Solche Systeme sind oft komplex und verlangen eine saubere Einrichtung – ganz ähnlich wie bei der Konfiguration von Servern. Eine gründliche Planung, wie man sie zum Beispiel braucht, wenn man einen FTP-Server einrichten will, ist auch hier entscheidend, um die Vorteile am Ende wirklich nutzen zu können.
Die Entscheidung für ein Tool ist eine langfristige Investition. Denken Sie nicht nur an die heutigen Anforderungen, sondern auch daran, wie das System in Zukunft mitwachsen kann. Ein späterer Systemwechsel ist fast immer mit enormem Aufwand verbunden.
Was genau ist eigentlich ein redaktionssystem?
Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist das Redaktionssystem, oft synonym für ein CCMS verwendet. Der Clou bei diesen Systemen ist die strikte Trennung von Inhalt, Struktur und Layout. Das heißt, die Autoren konzentrieren sich voll und ganz aufs Schreiben. Um die richtige Formatierung und die Veröffentlichung auf den verschiedenen Kanälen kümmert sich das System dann automatisch. Das spart nicht nur Zeit, sondern sichert auch eine durchgängige Konsistenz.
Um die richtige Wahl zu treffen, ist es hilfreich, die verschiedenen Software-Arten direkt zu vergleichen. Jede hat ihre spezifischen Stärken und Schwächen, die man gegen die eigenen Anforderungen abwägen muss.
Vergleich von Dokumentationswerkzeugen
Ein Überblick über verschiedene Arten von Software zur Erstellung technischer Dokumentation mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen.
| Werkzeugtyp | Vorteile | Nachteile | Ideal für |
|---|---|---|---|
| Wiki-Systeme | Einfache Zusammenarbeit, schnell startklar, meist kostengünstig | Begrenzte Layout-Kontrolle, weniger für formale Print-Dokus geeignet | Interne Wissensdatenbanken, agiles Projektmanagement |
| Hilfe-Autoren-Tools (HATs) | Single-Source-Publishing, starke Kontrolle über das Ausgabeformat, gut für strukturierte Inhalte | Steilere Lernkurve als Wikis, Zusammenarbeit kann umständlicher sein | Benutzerhandbücher, Online-Hilfen, gedruckte Anleitungen |
| CCMS | Maximale Wiederverwendung, ideal für Übersetzungen, granulare Versionskontrolle | Hohe Anschaffungs- und Implementierungskosten, sehr komplex | Unternehmen mit vielen Produktvarianten, hohem Übersetzungsaufwand, strengen regulatorischen Anforderungen |
Dieser Vergleich macht deutlich, dass die "beste" Lösung immer vom konkreten Anwendungsfall abhängt. Es gibt keine Universallösung, die für jeden passt.
So finden sie die passende lösung
Die Auswahl des passenden Werkzeugs ist keine Bauchentscheidung. Sie hängt von harten Fakten ab, die Sie am besten im Team klären. Stellen Sie sich folgende Fragen, um eine solide Basis für Ihre Entscheidung zu schaffen:
- Komplexität und Umfang: Wie groß sind Ihre Dokumente? Müssen Sie Dutzende Produktvarianten mit nur leichten Unterschieden in den Anleitungen managen? Je komplexer das Ganze wird, desto lauter schreit es nach einem CCMS.
- Teamgröße und Zusammenarbeit: Arbeiten mehrere Autoren gleichzeitig an der Dokumentation? Brauchen Sie saubere Freigabeworkflows und eine lückenlose Versionierung? Hier punkten ganz klar Wiki-Systeme und CCMS.
- Wiederverwendung und Übersetzung: Gibt es Textbausteine wie Sicherheitshinweise, die in x verschiedenen Dokumenten auftauchen? Planen Sie, Ihre Dokumentation in mehrere Sprachen zu übersetzen? Dann sind HATs und vor allem CCMS die richtigen Werkzeuge.
- Budget und Ressourcen: Die Kosten sind eine weite Spanne. Sie reichen von kostenlosen Open-Source-Wikis bis hin zu sechsstelligen Beträgen für die Einführung eines großen CCMS. Denken Sie dabei nicht nur an die Lizenzkosten, sondern auch an den Aufwand für Schulungen und die laufende Wartung.
Neben den reinen Erstellungstools lohnt sich auch ein Blick auf die Prozesse danach. Technische Dokumentationen landen oft als PDF beim Kunden. Deshalb können effektive Methoden und Tools zum Durchsuchen von PDF-Dokumenten die tägliche Arbeit enorm erleichtern – sowohl für Sie als auch für Ihre Nutzer.
Eine durchdachte Werkzeugauswahl ist das Fundament, auf dem Ihre gesamte technische Dokumentation steht. Sie entscheidet darüber, wie effizient Sie arbeiten und legt damit den Grundstein für den Erfolg des ganzen Projekts.
Inhalte klar strukturieren und verständlich formulieren
Haben wir die Strategie festgelegt und die richtigen Werkzeuge zur Hand, geht es ans Eingemachte: den Inhalt. An diesem Punkt entscheidet sich, ob Ihre technische Dokumentation eine echte Hilfe ist oder die Leute nur noch ratloser zurücklässt. Eine glasklare Struktur und eine verständliche Sprache sind hier das A und O. Sie sind der Unterschied zwischen einer schnellen Lösung und stundenlanger, frustrierter Suche.
Die eigentliche Kunst besteht darin, komplexe technische Zusammenhänge so einfach und präzise wie möglich auf den Punkt zu bringen. Es geht nicht darum, mit Fachwissen zu prahlen, sondern den Anwender sicher und ohne Umwege ans Ziel zu führen. Jeder Satz muss sitzen, jedes Bild eine klare Botschaft haben.
Vom Chaos zur Ordnung: Die richtige Struktur finden
Eine logische Struktur ist wie eine gute Beschilderung in einer fremden Stadt. Nutzer müssen instinktiv wissen, wo sie welche Informationen finden. Ein Ansatz, der sich in der Praxis immer wieder bewährt hat, ist der Weg vom Allgemeinen zum Speziellen. Starten Sie mit dem großen Ganzen und tauchen Sie dann Schritt für Schritt tiefer in die Details ein.
Für ein klassisches Benutzerhandbuch könnte ein bewährter Aufbau zum Beispiel so aussehen:
- Einleitung und Sicherheitshinweise: Hier gehören grundlegende Infos zum Produkt und – ganz wichtig – alle sicherheitsrelevanten Warnungen hin. Dieser Teil ist oft sogar gesetzlich vorgeschrieben und sollte absolute Priorität genießen.
- Erste Schritte (Getting Started): Ein kurzes Kapitel, das dem Nutzer schnell zum ersten Erfolgserlebnis verhilft. Denken Sie an die Installation oder die allererste Inbetriebnahme.
- Funktionsbeschreibungen: Hier erklären Sie detailliert alle Funktionen. Am besten gruppieren Sie diese nach typischen Anwendungsfällen oder entlang der Menüstruktur.
- Fehlerbehebung (Troubleshooting): Eine Liste mit den häufigsten Problemen und den passenden Lösungen. Glauben Sie mir, das kann die Anfragen an Ihren Support dramatisch reduzieren.
- Anhang: Der perfekte Ort für technische Daten, ein Glossar mit Fachbegriffen oder einen Index zum schnellen Nachschlagen.
Versetzen Sie sich immer in die Lage des Nutzers. Was ist das Allererste, was er tun möchte? Bauen Sie Ihre Inhalte entlang dieser typischen Arbeitsabläufe auf, nicht entlang der internen Produktarchitektur.
Dieser nutzerzentrierte Blick sorgt dafür, dass sich die Doku natürlich anfühlt und die Leser ohne langes Suchen genau das finden, was sie brauchen.
Verständlichkeit ist das oberste Gebot
Die beste Struktur bringt nichts, wenn der Text selbst ein Buch mit sieben Siegeln ist. Technische Redakteure sind im Grunde Übersetzer: Sie nehmen komplizierte Fachsprache und formen daraus einfache, klare Handlungsanweisungen. Dabei gibt es ein paar goldene Regeln, die Sie sich zu Herzen nehmen sollten.
1. Schreiben Sie aktiv, nicht passiv
Passivkonstruktionen klingen oft hölzern und verschleiern, wer eigentlich was tun soll. Formulieren Sie direkt und aktiv, dann sind Ihre Anweisungen unmissverständlich.
- So lieber nicht: „Der Button muss geklickt werden, um das Fenster zu öffnen.“
- Besser so: „Klicken Sie auf den Button, um das Fenster zu öffnen.“
Dieser kleine Dreh hat eine enorme Wirkung. Die aktive Variante ist kürzer, direkter und eine viel klarere Aufforderung.
2. Halten Sie die Sätze kurz und knackig
Vermeiden Sie lange, verschachtelte Satzungetüme. Eine gute Faustregel ist: ein Gedanke pro Satz. Studien haben gezeigt, dass Sätze mit mehr als 20 Wörtern deutlich schwerer zu verstehen sind. Kurze Sätze kann man einfach besser überfliegen und verarbeiten.
3. Bleiben Sie bei Ihrer Terminologie
Entscheiden Sie sich für einen Begriff und bleiben Sie konsequent dabei. Nennen Sie einen Button nicht erst „Speichern“, dann „Sichern“ und später „Bestätigen“. Solche Inkonsistenzen stiften nur Verwirrung und kratzen am Vertrauen in Ihre Dokumentation. Ein Glossar ist hier ein unschätzbares Werkzeug, um die verbindlichen Begriffe festzuhalten und für das ganze Team zugänglich zu machen.
Visuelle Hilfsmittel gezielt einsetzen
Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte – dieser Spruch ist in der technischen Dokumentation Gold wert. Visuelle Elemente sind keine Dekoration, sondern essenzielle Werkzeuge, um Informationen schneller und leichter verdaulich zu machen.
Screenshots mit Köpfchen
Screenshots sind unverzichtbar, um zu zeigen, wo ein Nutzer klicken oder etwas eingeben soll. Aber einfach nur ein Bild hinklatschen, reicht oft nicht aus.
- Heben Sie das Wichtige hervor: Nutzen Sie Pfeile, Kreise oder farbige Rahmen, um den Blick direkt auf das entscheidende Element der Benutzeroberfläche zu lenken.
- Nummerieren Sie Handlungsschritte: Wenn in einem Bild mehrere Aktionen nötig sind, hilft eine klare Nummerierung, die richtige Reihenfolge einzuhalten.
- Schwärzen Sie Unwichtiges: Entfernen Sie irrelevante oder sensible Daten. Das schützt nicht nur die Privatsphäre, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was wirklich zählt.
Diagramme und Fließschemata
Wenn Sie Prozesse oder Systemarchitekturen erklären müssen, sind Diagramme unschlagbar. Ein Fließschema kann einen komplexen Arbeitsablauf viel eingängiger darstellen als eine noch so lange Textbeschreibung. Es macht Zusammenhänge und Entscheidungspunkte auf einen Blick sichtbar.
Wenn Sie präzisen Text, eine klare Struktur und sinnvolle visuelle Hilfen kombinieren, erschaffen Sie eine technische Dokumentation, die mehr ist als nur eine lästige Pflicht. Sie wird zu einer verlässlichen Ressource, die Ihren Anwendern hilft, das Produkt optimal zu nutzen – und ganz nebenbei Ihr Support-Team nachhaltig entlastet.
Kosten und Aufwand realistisch einschätzen
Eines der größten Missverständnisse bei der Erstellung technischer Dokumentation? Die Kosten. Viel zu oft wird der Aufwand dramatisch unterschätzt. Man startet mit einer viel zu optimistischen Budgetplanung, die dann unweigerlich zu Engpässen, Stress und Kompromissen bei der Qualität führt. Ein ehrlicher, harter Blick auf die realen Kostenfaktoren ist daher kein „nice-to-have“, sondern absolut essenziell.
Es geht hier eben nicht darum, dass ein Mitarbeiter mal eben schnell was zusammenschreibt. Professionelle Dokumentation ist ein eigenständiges Projekt, das Expertise, Ressourcen und die richtigen Werkzeuge erfordert.
Der größte Brocken: Personalkosten
Seien wir ehrlich: Der mit Abstand größte Posten auf der Rechnung sind die Personalkosten. Egal, ob Sie auf interne technische Redakteure setzen oder externe Dienstleister an Bord holen – qualifizierte Fachkräfte kosten Geld. Und das zu Recht, denn ihre Expertise macht den Unterschied. Sie übersetzen komplexe Technik in verständliche Sprache, kennen die rechtlichen Fallstricke und arbeiten effizient mit spezialisierter Software.
Der Versuch, den Aufwand pauschal pro Seite zu kalkulieren, ist übrigens ein Trugschluss, den ich schon oft erlebt habe. Der tatsächliche Aufwand hängt nicht von der Seitenzahl ab, sondern von der Tiefe des Inhalts, dem Rechercheaufwand, der Erstellung von Grafiken und den unvermeidlichen Abstimmungsschleifen mit den Fachexperten.
Die Annahme, technische Dokumentation sei ein Nebenprodukt, das ohne dediziertes Budget entsteht, ist einer der teuersten Irrtümer in der Produktentwicklung. Die Folgekosten durch Supportanfragen, Haftungsfälle oder Verzögerungen übersteigen die anfängliche Investition oft um ein Vielfaches.
Software und Infrastruktur
Professionelle Ergebnisse verlangen nach professionellen Werkzeugen. Klar, bei einem kleinen, internen Projekt mag ein Standard-Office-Programm noch ausreichen. Sobald es aber komplexer wird, kommen Sie um spezialisierte Software nicht mehr herum.
Diese Tools sind keine Spielerei, sondern entscheidend für Effizienz und Qualität:
- Redaktionssysteme (CCMS): Die Lizenzen können schnell mehrere Tausend Euro pro Jahr kosten. Dafür ermöglichen sie durch die Wiederverwendung von Inhalten (Single Sourcing) eine enorme Zeit- und Kostenersparnis – vor allem bei Produktvarianten und Übersetzungen.
- Grafik- und Bildbearbeitungstools: Hochwertige Illustrationen, kommentierte Screenshots und klare Diagramme erstellen sich nicht von selbst. Hier sind professionelle Programme wie die der Adobe Creative Cloud oder Affinity Suite der Standard.
- Projektmanagement-Software: Um bei Aufgaben, Fristen und Freigabeschleifen nicht den Überblick zu verlieren, ist ein Tool wie Jira oder Asana Gold wert.
Diese Kosten sind oft wiederkehrend und gehören fest in die langfristige Budgetplanung. Denken Sie auch an die IT-Infrastruktur. Ein komplexes Server-Setup, wie es für die Verwaltung großer Datenmengen benötigt wird, erfordert ebenfalls Wartung und Know-how. Wer tiefer in die Grundlagen solcher Systeme einsteigen möchte, findet in unserem Artikel über RAID-Systeme wertvolle Informationen.
Die versteckten Kosten nicht vergessen
Neben den offensichtlichen Posten lauern oft „versteckte“ Aufwände, die ein Budget schnell sprengen können. Ganz oben auf der Liste: Übersetzungen und Lokalisierung. Wenn Ihr Produkt international auf den Markt kommt, muss die Dokumentation für jeden Zielmarkt nicht nur professionell übersetzt, sondern auch kulturell angepasst werden. Das kann den Gesamtaufwand leicht vervielfachen.
Auch der interne Review- und Freigabeprozess frisst erhebliche Ressourcen. Fachexperten, Entwickler und vielleicht sogar Juristen müssen die Inhalte prüfen – und deren Zeit ist wertvoll und knapp. Je mehr Stakeholder involviert sind, desto länger und komplexer wird dieser Prozess.
Um das mal in eine konkrete Größenordnung zu bringen: Ein technisches Dokument in Deutschland hat oft mindestens 40 Seiten pro Sprache. Die Erstellung einer einzigen A4-Seite kann, je nach Komplexität, mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Während unerfahrene Firmen manchmal mit Budgets unter 1.000 Euro planen, zeigt die Praxis, dass die tatsächlichen Kosten für eine professionelle Umsetzung eher im Bereich von 6.000 bis 10.000 Euro liegen. Eine ähnliche Einschätzung finden Sie bei der GFT-Akademie.
Eine ehrliche und realistische Einschätzung aller Kostenfaktoren schützt also vor bösen Überraschungen. Sie macht deutlich: Die Investition in hochwertige Doku ist keine lästige Pflicht, sondern eine strategische Entscheidung, die Ihnen langfristig teure Supportanfragen und rechtliche Risiken erspart.
Häufige fragen zur technischen dokumentation
Nachdem wir uns durch den gesamten Prozess von der Planung über die Inhaltserstellung bis hin zur Kostenkalkulation gearbeitet haben, gibt es meist noch ein paar konkrete Punkte, die im Raum stehen. In diesem Abschnitt beantworte ich einige der Fragen, die mir in der Praxis immer wieder begegnen. Sehen Sie es als eine Art kompaktes Nachschlagewerk für schnelle, klare Antworten.
Diese FAQs sollen letzte Unsicherheiten aus dem Weg räumen und Ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit Normen, Gesetzen und den täglichen Hürden der Dokumentationserstellung geben.
Was genau ist technische dokumentation?
Im Grunde genommen meint technische Dokumentation alles, was ein Produkt beschreibt – von der ersten Idee über die Herstellung bis hin zur sicheren Nutzung, Wartung und schlussendlich der Entsorgung. Es geht also um viel mehr als nur die klassische Bedienungsanleitung, die dem Kunden in die Hand gedrückt wird.
In der Praxis gehören dazu zum Beispiel:
- Benutzerhandbücher und Betriebsanleitungen: Der Klassiker. Richten sich an den Endanwender und erklären, wie das Produkt sicher und bestimmungsgemäß funktioniert.
- Installations- und Montageanleitungen: Diese sind für Fachpersonal gedacht und leiten Schritt für Schritt durch den Aufbau und die Inbetriebnahme.
- Service- und Wartungshandbücher: Hier finden Techniker alle Details, die sie für die Instandhaltung und Reparatur benötigen.
- Interne Dokumentation: Das ist der Teil, den der Kunde nie zu Gesicht bekommt. Dazu zählen Konstruktionszeichnungen, Risikobeurteilungen und Konformitätserklärungen, die zum Beispiel für die CE-Kennzeichnung unverzichtbar sind.
Das übergeordnete Ziel ist immer dasselbe: Informationen so aufzubereiten, dass das Produkt sicher, effizient und wie vorgesehen genutzt werden kann.
Wer darf technische dokumentation erstellen?
Eine Frage, die fast immer aufkommt: Wer ist eigentlich qualifiziert genug, um diese wichtigen Dokumente zu schreiben? Die kurze Antwort: Grundsätzlich jeder. Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung oder ein Zertifikat, das man dafür braucht. Aber – und das ist der entscheidende Punkt – die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit liegt immer beim Hersteller.
Die rechtliche Verantwortung lässt sich nicht delegieren. Selbst wenn Sie einen externen Dienstleister beauftragen, bleiben Sie als Hersteller für fehlerhafte oder unvollständige Dokumente in der Haftung.
Aus diesem Grund wird diese Aufgabe in der Praxis meist von technischen Redakteuren übernommen. Diese Profis bringen eine besondere Mischung aus technischem Sachverstand, didaktischem Geschick und dem nötigen Wissen über relevante Normen und Richtlinien mit. Ihre Expertise sorgt dafür, dass die Doku nicht nur fachlich korrekt ist, sondern auch von der Zielgruppe verstanden wird und allen rechtlichen Anforderungen genügt.
Wie wichtig diese Spezialisten sind, zeigen auch die Branchenzahlen. In Deutschland arbeiten rund 94.872 Personen in der technischen Kommunikation, von denen sich etwa 77.905 hauptsächlich mit der Erstellung technischer Dokumentation befassen. Wer tiefer in die Zahlen eintauchen möchte, kann sich die tekom-Studie zur Branchenverteilung ansehen.
Welche normen und richtlinien sind wichtig?
Das regulatorische Umfeld kann auf den ersten Blick ganz schön unübersichtlich wirken. Die wohl wichtigste Anforderung für die meisten Produkte in der EU ist die CE-Kennzeichnung. Sie ist im Grunde die Bestätigung des Herstellers, dass sein Produkt allen geltenden EU-Richtlinien entspricht. Und die technische Dokumentation ist ein zwingend erforderlicher Teil dieses Prozesses.
Ein paar zentrale Normen sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben:
- DIN EN IEC/IEEE 82079-1: Man könnte sie als die „Mutter aller Normen“ für Nutzungsinformationen bezeichnen. Sie legt die allgemeinen Grundsätze und Anforderungen an die Qualität und den Inhalt von Anleitungen fest.
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Für jeden Maschinenhersteller ist diese Richtlinie das A und O. Sie schreibt ganz genau vor, was in einer Betriebsanleitung stehen muss.
- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG): Dieses deutsche Gesetz überführt die europäischen Richtlinien in nationales Recht und regelt die Sicherheitsanforderungen für Produkte, die auf dem deutschen Markt verkauft werden.
Es ist absolut entscheidend, sich mit den für das eigene Produkt relevanten Vorschriften vertraut zu machen. Unwissenheit schützt hier nämlich nicht vor den Konsequenzen – und die können von Verkaufsverboten bis zu empfindlichen Strafen reichen.
Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie professionelle Unterstützung bei der Absicherung Ihrer IT-Infrastruktur, die oft die Basis für Ihre Dokumentationsprozesse bildet? Deeken.Technology GmbH ist Ihr ISO 27001 zertifizierter Partner für IT-Sicherheit, NIS-2-Compliance und umfassende IT-Dienstleistungen. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung unter https://deeken-group.com.


